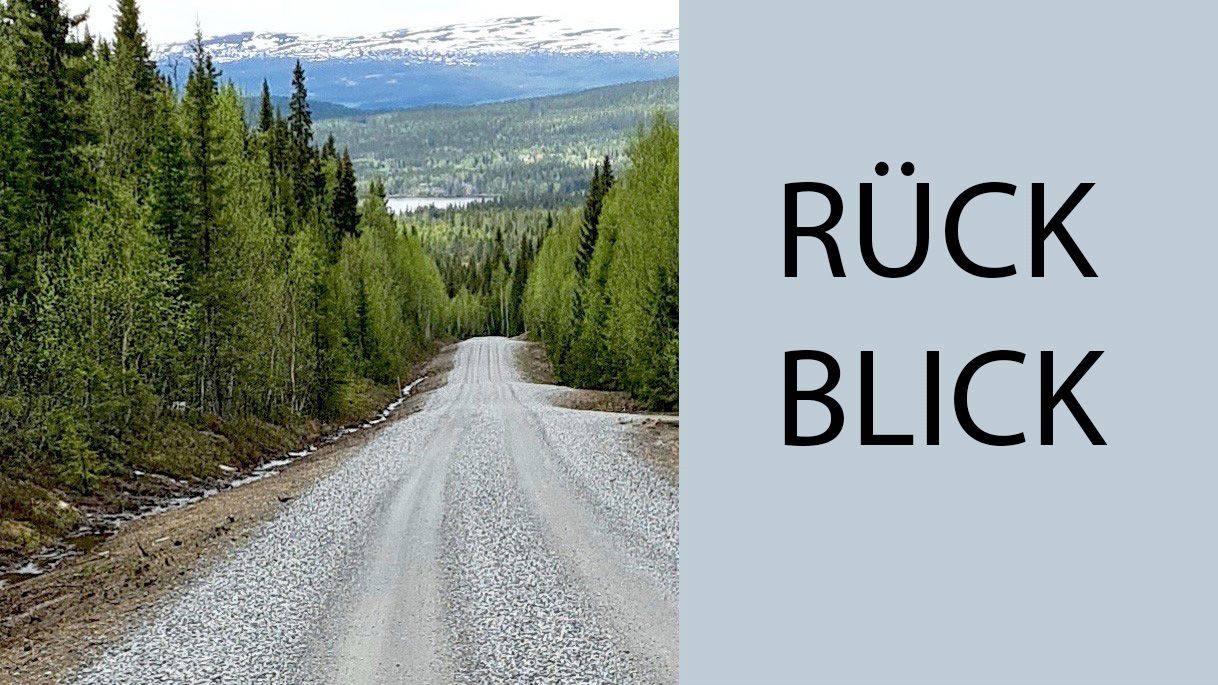Facettenreiche Existenz -
Schopenhauers Philosophie als Knotenpunkt der Disziplinen
24. Februar 2023 | Gastbeitrag
Von Michael Steinmetz und Dominik Zink
Auf den ersten Blick kommt Schopenhauers Denken eine Randstellung innerhalb des philosophischen Diskurses der Moderne zu, einerseits innerhalb des Kanons der philosophischen Entwürfe seiner Zeit, andererseits wurde seine Philosophie auch im 20. Jahrhundert nicht selten missgünstig beurteilt, so etwa als aporetisch oder aber veraltet. Demgegenüber möchte der Sammelband dazu beitragen, Schopenhauers Denken als genuin modern und in vielfältiger Weise anschlussfähig an aktuelle Diskurse auszuweisen – und zwar über die Grenzen der Philosophie hinaus. So sind es nicht zuletzt die spezifischen Eigenheiten seines philosophischen Entwurfs – seine Weigerung, reduktionistische Beschreibungen vorzunehmen, die zentrale Stellung des Leibes, die fruchtbare Integration empirischer Disziplinen sowie der literarische Gehalt seines Werks –, welche den Blick auf die menschliche Existenz in ihrer Gebrochenheit sowie ihrem Facettenreichtum freilegen.
In sieben Beiträgen wird Schopenhauers Verhältnis zu unterschiedlichen Diskursen der Moderne neu befragt:
Reto Rössler untersucht in seinem Beitrag Schopenhauers Praktiken der Autorschafts- und Werkinszenierung, die den modifizierten Bedingungen der Aufmerksamkeitsökonomie des 19. Jahrhunderts – einer im Entstehen begriffenen bürgerlichen Öffentlichkeit sowie der fortschreitenden Ausdifferenzierung des Literaturmarktes – Rechnung trägt. Schopenhauer zeichnet sich gleichsam durch das gekonnte Spiel von Adaption sowie gezieltem Bruch mit zeitgenössischen Praktiken der Inszenierung aus.
Dominik Zink geht der Frage nach dem Verhältnis Schopenhauers zur (früh-)romantischen Ästhetik nach, die auch sprachphilosophisch die Moderne einleitet. Er entwirft ein differenziertes Bild dieses Verhältnisses, das Überschneidungen mit Berliner Romantikern wie Tieck und Wackenroder ebenso berücksichtigt wie formal-ästhetische Differenzen zu Jenaer Romantikern wie Novalis und Schlegel.
Christophe Bouriau weist in seinem Beitrag die Aktualität Schopenhauers hinsichtlich gegenwärtiger Fragen der Religionsphilosophie aus. Schopenhauer nimmt eine Reihe von Thesen und Argumenten vorweg, die sich in aktuellen Beiträgen zum theologischen Fiktionalismus wiederfinden, so etwa bei Don Cupitt, Robin Le Poidevin sowie Peter Jonkers.
Rémy Poels widmet seinen Beitrag dem Problem des Übels. Schopenhauer verortet das Problem neu, indem er es aus seiner klassisch metaphysischen Rahmung auslöst, welche die Frage nach der Existenz des Übels in der Welt ausschließlich auf die Allmacht und Allgüte Gottes bezieht. Stattdessen verbindet er das Problem mit der Existenz des Menschen, die in ihrer radikalen Konfliktivität offengelegt wird.
Carsten Olk verfolgt den Zusammenhang von musikästhetischem Erleben und Mitleidsethik bei Schopenhauer. Die durch die Musik hervorgerufene kontemplative Schau des Willens wird als hinreichende Bedingung der Mitleidsinitiation interpretiert. Damit öffnet sich die Perspektive auf das praktische Anwendungsfeld eines musikpädagogischen Compassion-Trainings, u.a. im Rahmen schulischer Bildung.
Katharina Probst untersucht die Ambivalenz von Schopenhauers Ethik im Spannungsfeld seines rein deskriptiven Ansatzes einerseits, normativer und sogar präskriptiver Tendenzen andererseits. Schopenhauers Anspruch, eine deskriptive Ethik zu formulieren, leitet sich aus seinem Determinismus ab. Seine Behauptung eines ethischen Werts von Handlungen sprengt jedoch die engen Grenzen des deskriptiven Ansatzes und führt ihn dazu, seine Ethik mit normativen und sogar präskriptiven Aussagen anzureichern.
Michael Steinmetz geht in einem Vergleich mit Paul Ricœur der Frage nach der Aktualität Schopenhauers für eine hermeneutisch-phänomenologische Theorie der Willensfreiheit nach. Schopenhauers Aktualität erscheint darin ambivalent, insofern er einerseits den Grundstein einer hermeneutischen Vermittlung von Freiheit und Notwendigkeit legt, diese Vermittlung andererseits nicht konsequent zu Ende führt. |

Michael Steinmetz/Dominik Zink (Hg.): Facettenreiche Existenz. Schopenhauers Philosophie als Knotenpunkt der Disziplinen. Würzburg: Königshausen & Neumann 2023. | mehr erfahren (externe Verlagsseite)
Die Autoren
-
Michael SteinmetzListenelement 1
Michael Steinmetz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Theoretische Philosophie des 19. und 20. Jahrhunderts der Universität Trier. Den Schwerpunkt seiner Forschung bildet die französische Phänomenologie. Seine Dissertation mit dem Titel "Subjektivität und Psychoanalyse – Zur Funktion der Dezentrierung des Subjekts in den Freud-Interpretationen Jacques Lacans und Paul Ricœurs" wurde im Sommer 2022 eingereicht.
-
Dominik ZinkListenelement 2
Dominik Zink ist Juniorprofessor für interkulturelle Literaturwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er promovierte an der Europa-Universität Flensburg mit der Arbeit "Interkulturelles Gedächtnis: ost-westliche Transfers bei Saša Stanišić, Nino Haratischwili, Julya Rabinowich, Richard Wagner, Aglaja Veteranyi und Herta Müller". Seine Forschungsschwerpunkte sind Ähnlichkeit, Herkunft, Romantik und Gegenwartsliteratur.